Kongressbericht
«Psychotherapy, stronger through Diversity», IFP Weltkongress, 7.–9. Juni 2018, Amsterdam
Psychotherapie-Wissenschaft 8 (2) 85–86 2018
www.psychotherapie-wissenschaft.info
https://doi.org/10.30820/8243.16
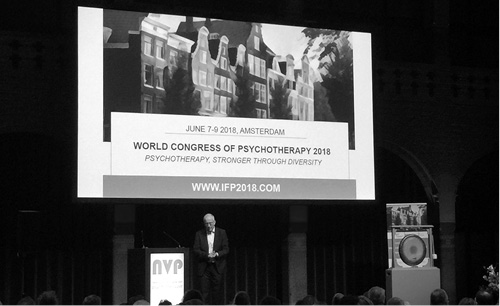
Die ASP bzw. die Charta, ist Mitglied der IFP (International Federation for Psychotherapy), die alle vier Jahre einen Weltkongress veranstaltet. Dieses Jahr fand er unter dem Titel «Psychotherapy, stonger through Diversity» in Amsterdam statt. Vor Ort organisierte der Holländische Verein für Psychotherapie den Kongress. Er fand in der alten Börse (Beurse van Berlage) am Dam mitten im Zentrum von Amsterdam statt – ein sehr geeigneter Kongressort mit guter Ausstattung. Etwa 850 PsychotherapeutInnen aus allen Kontinenten nahmen teil. Den Hauptharst bildeten natürlich die KollegInnen aus Holland. Inhaltlich war der Kongress sehr anregend und vielfältig. Am Vormittag des ersten Kongresstages fanden Pre-Congress-Workshops statt, zum Beispiel von Lesley Greenberg zu «The Theory and Practice of Emotion Focused Therapy», von Bruce Wampold zu «What makes Psychotherapy work», Jan Ilhan Kazilhan zu «Genocide, Trauma and Sexual Violation – Terror crimes against religuous minorities in the middle east» und anderen. Die Hauptreferate wurden gehalten von Pim Cuijpers, Jan Ilhan Kizilhan, Marylene Cloitre, Leslie Greenberg, Robert DeRubeis und Bruce Wampold. Daneben fanden 71 Parallelveranstaltungen in Form von Symposien und Kurzvorträgen statt. Zählt man alle ReferentInnen der Symposien und der Hauptvorträge zusammen, so kommt man auf etwa 150 Präsentationen, die in drei Tagen geboten wurden. Inhaltlich gab es für die Parallelveranstaltungen verschiedene Themenschienen: Diversity; Transcultural Psychotherapy; Trauma; Personality Disorders; Anxiety and Depression; Child & Adolescent; Assessment; Novel; Group Psychotherapy; Attachment; Cognitive Psychotherapy; Psychodynamic Therapy; Therapeutic Relationship; E-Health; Routine Outcome Monitoring (ROM); Positive Psychology; Pharma; Theory; Art therapies; Personalized Psychotherapy; Psychomotor Psychotherapy; Schematherapy. Darunter gab es eine Menge von Einzelthemen, die hier gar nicht alle aufgeführt werden können. Das Programmheft war so gestaltet, dass man die Veranstaltungen nicht nur zeitlich auflistete, sondern auch zu den entsprechenden Rahmenthemen/Themenschienen. Das erleichterte die Orientierung für die Auswahl, was man besuchen wollte.
Nur so viel: Es war äusserst bereichernd, aus dieser Vielfalt von Angeboten jene Themen auszusuchen, die einen interessierten; und die Angebote waren zumeist von sehr guter Qualität – eine echte Fortbildung also, die die Reise und den Zeitaufwand wert war. Und Amsterdam ist eh immer eine Reise wert, auch aus kultureller Sicht. Manche sind denn auch etwas früher schon angereist oder etwas länger geblieben, um auch etwas von der Stadt zu haben.
Im Rahmen eines solchen Berichts kann natürlich nicht über alles Berichtenswerte berichtet werden, viel mehr muss eine Auswahl getroffen werden, die sich auch an den persönlichen Interessen des Berichterstatters orientiert. Dieser verfolgte hauptsächlich die Schiene der transkulturellen Aspekte der Psychotherapie, nicht zuletzt, weil er selbst in verschiedenen Ländern und Kulturen arbeitete, sondern auch weil er gerade dabei war, das vorliegende Heft der Psychotherapie Wissenschaft herauszugeben. Im Folgenden seien kurz die Inhalte der Keynotes zusammengefasst dargestellt.
Als Eröffnungsvortrag sprach Pim Cuijpers zum Thema «Four Decades of Outcome Research of Psychotherapy: Lessons for the Future». In Hunderten sogenannter Randomized Controlled Trials (RCT; dt.: Randomisierte kontrollierte Studie) seien die Effekte der Psychotherapie für psychische Störungen untersucht worden. Er gab eine Übersicht über diese Studien und fasste zusammen, was man daraus lernen konnte. Im Besonderen fokussierte er dann auf die Therapie von depressiven und Angst-Störungen, um herauszuarbeiten, wann sie wirken und für wen. Er folgerte, dass man trotz all dieser Studien noch wenig sagen könne, was die Psychotherapie in der Praxis und der therapeutischen Beziehung denn wirklich effektvoll mache, und er meinte, hier müsse der Fokus weiterer Forschung liegen: Welche Kompetenzen von PsychotherapeutInnen helfen welchen Patienten mit ihren eigenen Kompetenzen, von einer Psychotherapie wirklich zu profitieren?
Jan Ilhan Kizilhan, ein Kurde, der als Kind mit seinen Eltern aus der Türkei nach Deutschland kam, arbeitet als Traumaexperte und Experte für transkulturelle Psychotherapie in Deutschland. Er sprach zum Thema «Genocide, Trauma and sexual violation – Terror crimes against religion minorities in Middle East». Er leitete ein Projekt, das 1100 Frauen und Kinder medizinische und psychotherapeutische Hilfe zukommen liess, die Zeugen des Genozides und Terrors durch IS-Kämpfer an Jesiden im Sommer 2014 im Nordirak geworden sind. 7000 Menschen sind gefangengenommen, 5000 getötet worden, hauptsächlich Männer. Gefangene Frauen und Mädchen sind mit dem Ziel, ihre Würde und Ehre in ihrer Gesellschaft zu zerstören, vergewaltigt worden. Er zeigte, wie die Jesiden an einer dreifachen Traumatisierung leiden: einer individuell kürzlich erlittenen, einer transgenerationalen und einer kollektiven. Insgesamt 73 Mal fanden Genozide gegen dieses Volk im Laufe der Herrschaft des osmanischen Reiches statt. Verständlich, dass so tief verwurzelte traumatische Instabilität eine narrative Therapie sehr kompliziert macht, in der einem Individuum geholfen wird, sich mit der eigenen Geschichte und Werten zu identifizieren und sich mit den Problemen zu konfrontieren, die sie haben.
Marylene Cloitre ist eine PTSD Spezialistin und lehrt in Palo Alto, Kalifornien. In ihrer Forschung und klinischen Arbeit fokussierte sie die letzten 20 Jahre auf Langzeiteffekte von chronischen Traumatisierungen auf das soziale und emotionale Funktionieren. Aktuell beschäftigt sie sich mit der Entwicklung von effektiven, auf den Patienten zugeschnittenen flexiblen Mental-Help-Programmen. Sie sprach zu «Trauma Recovery: The Art and Science of Treating the Whole Person». Sie zeigte auf, wie die wissenschaftlichen Paradigmen zur Behandlung von Traumata und die persönlichen Bedürfnisse der PatientInnen in einer Spannung stünden. Sie plädierte dafür, diese Spannung anzuerkennen und in die Dynamik der therapeutischen Beziehung einzubeziehen, um individuell flexibel vorzugehen und so eine bessere Synergie aus dieser Spannung hin zu erfolgreichen Therapiesitzungen und besserem Therapieerfolg zu erzielen.
Lesley Greenberg ist emeritierter Professor der York University in Kanada und ein sehr geachteter Forscher. Er entwickelte aus einer Kombination von Roger’scher Gesprächstherapie (empathische Haltung) und Gestalttherapie (konfrontative Techniken, insb. Zwei-Stuhl-Dialoge) und Erkenntnissen klinischer Forschung die Emotionsfokussierte Therapie (EFT). Er sprach zu «The Transforming Power of Affect». Er zeigte auf, dass es in der Psychotherapie nicht reicht, kognitive Erkenntnisse über emotionales Erleben zu gewinnen, sondern dass die Gefühle, die verbunden sind mit Lebensereignissen, transformiert werden müssen, damit sie sich ändern können. Dazu ist es unerlässlich, Gefühle, auch starke Emotionen auszudrücken, aber nicht im Sinne einer Repetition, sondern therapeutisch so begleitet, dass sie sich verändern können. Er untermauerte das mit Forschungsresultaten, die bessere Outcome-Resultate zeigen, wenn eine Veränderung der Emotionen wirklich gelingt.
Robert DeRubeis lehrt an der University of Pennsylvania. Er ist verhaltenstherapeutisch ausgerichtet und sprach zu «The promise of evidence-based personalized mental health practice». Aus der Menge vorliegender RCTs könnten unibasierte Schlüsse über durchschnittliche Therapieeffekte generiert werden. Diese Studien würden aber auch eine Menge Daten enthalten, die hinsichtlich einer personalisierten Psychotherapie genutzt werden könnten. Er zeigte, welche Forschungsresultate es zur Wahl der geeigneten Therapiemethode, den Zielen und den Verhaltensmustern der PatientInnen in der Therapie bereits gibt und wie im Hinblick auf eine personalisierte Psychotherapie weiter geforscht werden müsste.
Bruce Wampold forscht heute in Norwegen und ist emeritierter Professor der University of Wisconsin. Er sprach zu «How to be a better Therapist». Ihn interessiert die Evidenz für das, was macht, dass Psychotherapie wirklich erfolgreich ist, und wie die Therapieeffekte anhalten können. Auch wenn heute allgemein anerkannt sei, dass Psychotherapie wirke, wisse man noch wenig darüber, weshalb sie manchmal helfe und manchmal auch nicht. Er zeigte, wie Psychotherapie über vielfältige Wege wirkt und dass die therapierende Person, die eine bestimmte Therapie leitet, für den Erfolg entscheidend sei. Es zeige sich, dass TherapeutInnen mit breiteren Interventions-Fertigkeiten und besseren interpersonellen Kompetenzen erfolgreicher arbeiten würden als andere. An seinem Norwegischen Institut haben sie ein EDV-unterstütztes Programm mit Übungen entwickelt, die für die Verbesserung der Interventions- und interpersonellen Skills hilfreich in der PsychotherapeutInnen-Weiterbildung eingesetzt werden könnten.
Zum Abschluss des Kongresses gab es ein Podium mit dem Titel «The Great Psychotherapy Debate». Unter der Leitung von Marcus Huibers sollten Robert DeRubeis, Stephan Doering (Wien), Les Greenberg, Nelleke Nicolai und Bruce Wampold kontrovers zur Frage, was denn nun entscheidend für eine erfolgreiche Psychotherapie sei, debattieren. Die Diskussion sollte dabei nicht erneut den Einfluss spezifischer und genereller Faktoren repetieren, sondern auf eine Richtung vorwärts verweisen. Was wissen wir über die Wirkungsweise der Psychotherapie und wie können wir da noch weiter vorwärtskommen?
Die Debatte fand dann aber nicht so kontrovers wie angedacht statt, da die Teilnehmenden viel Übereinstimmung fanden. So wurde herausgearbeitet, dass der Beziehungsqualität, der therapeutischen Allianz, der Bearbeitung bzw. Veränderung von Gefühlen, der personalisierten Anwendung von Psychotherapie und der Persönlichkeitsentwicklung der TherapeutInnen mehr Beachtung in klinischer Praxis und Forschung zu geben sei. Diese Forschung und «Change Process Research» seien in Zukunft viel wichtiger, als weitere Vergleichsforschung zu machen, welche Methode der anderen überlegen oder ihr zumindest gleichwertig sei.
Die Forschungsförderungsagenturen müssen sich da auch umstellen. Es ist immer noch viel leichter, Geld für RCTs zu bekommen, die therapeutische Verfahren bei bestimmten Störungsbildern vergleichen, als für Studien, die die therapierende Person und ihre personale, interpersonelle und soziale Kompetenz, und wie das mit der Dynamik der PatientInnen (als Individuuen) zusammenwirkt, untersuchen.
Dieser Kongress war wirklich besuchenswert. Ich freue mich auf den nächsten in vier Jahren, der voraussichtlich in Marokko stattfinden wird, wo der neue Präsident, Prof. Driss Moussaoui, herkommt.
Peter Schulthess
Kontakt
peter.schulthess@psychotherapie.ch